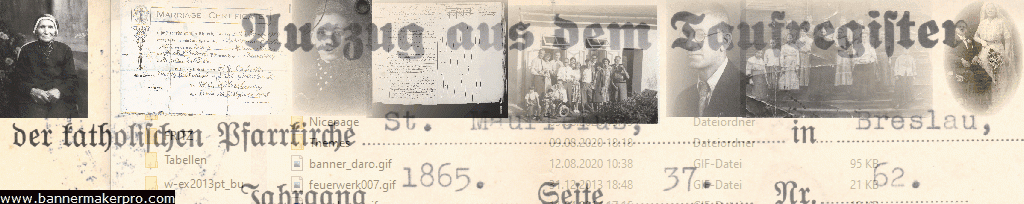Ich betreibe seit mehr als 35 Jahren Ahnenforschung und habe inzwischen fast vergessen, wie schwierig es damals war, an die Daten heranzukommen.
Ich betreibe seit mehr als 35 Jahren Ahnenforschung und habe inzwischen fast vergessen, wie schwierig es damals war, an die Daten heranzukommen.
Eigentlich hatte ich Glück, meine Mutter Renate Daroszewski, geborene Blobel, hinterließ mir eine kleine Schachtel prall gefüllt mit Dokumenten ihrer Vorfahren väterlicherseits. Meine Großeltern verließen 1938 Oberschlesien und mussten nachweisen, dass sie “deutschstämmig” waren. Mein Großvater Rudolf Blobel hatte also jede Menge amtlicher Dokumente aufbewahrt – ein wahrer Schatz.
Ich musste allerdings schnell erkennen, das amtliche Dokumente auch ihre Tücken haben. Das nebenstehende Bild zeigt die Sterbeurkunde meines Franz Carl Florian Bittner, sein Geburtsort wäre demnach Lanterbach. Das stimmt aber nicht, er wurde in Langseifersdorf, Lauterbach Kreis Reichenbach in Schlesien geboren. Das habe ich über andere vorhandene Dokumente herausgefunden und die Namenslinie immerhin bis 1748 zurückverfolgen können.
Nun hat nicht jeder das Glück, einen solchen Schatz zu finden, aber – und das ist die gute Nachricht – in Deutschland, vielmehr im Deutschen Reich gibt es per Gesetz seit dem 1. Januar 1876 Standesämter. Jede Geburt, jede Hochzeit und jeder Tod muss amtlich verzeichnet sein (allerdings können so manche Standesamtsunterlagen in den beiden Weltkriegen verloren gegangen sein).
In einigen Gebieten gibt es schon länger standesamtliche Unterlagen: in Baden seit 1870, in Preußen seit 1871 und in teilweise französisch regierten Gebieten wie Bremen wesentlich früher. Bremen registrierte ab 1811 im sogenannten “Zivilstandsregister”.
Um anzufangen benötigt man also Urkunden, in denen die Lebensorte unserer Vorfahren aufgeführt wurden. In Hochzeitsurkunden werden oft die Geburtsorte genannt, in Sterbeurkunden auch. Man kann sie beim jeweiligen Standesamt beantragen – wenn man ein berechtigtes Interesse als Nachfahre hat. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die betroffenen Personen verstorben sind.
Wenn ein Familienstammbuch existiert, hat das Brautpaar mindestens die eigene Hochzeit in diesem Stammbuch dokumentiert bekommen. Moderne Stammbücher sind so angelegt, dass amtliche Geburts- und Sterbeurkunden später dazugeheftet werden können (jedenfalls ist dies bei meinem so), ältere sind fest gebundene Bücher. Rechts im Bild ist die Kopie der kirchlichen Trauung meiner Eltern – Damazy Daroszewski und Renate Blobel – abgebildet. Als Taufort meines Vaters wird “Alexandrowo, St. Michael” angegeben. Ohne weitere Hintergrundinformationen aus der Familie hätte ich keine Chance gehabt, den Geburtsort herauszufinden, denn in Polen dürfte es dutzende Orte geben, die Alexandrowo heißen und hunderte Kirchen, die mit St. Michael benannt werden.
Erste Anlaufpunkt ist also ein Familienstammbuch, wenn das nicht verfügbar ist und der Hochzeitsort bekannt ist, wird das zuständige Standesamt angefragt. Fragt eine Abschrift und keine beglaubigte Urkunde an, denn die ist teuer.
Warum sollte man sich überhaupt die Mühe machen, die Daten mit Urkunden zu beweisen? Ich lese in den sozialen Medien immer wieder, dass man wunderbarerweise auf Anbietern wie Myheritage, Ancestry oder Familysearch Daten findet. Die beiden ersten sind kostenpflichtet, Familysearch nicht.
Ja, man findet Daten, aber die sind oft falsch und / oder widersprüchlich. Mein Familienname wird weltweit von verschiedenen “Forschern” gesucht und die tragen lustig gefundenen Daten ein – obwohl sie teilweise offensichtlich falsch sind. Als einer meiner Großväter wird oft Jan Nepomucem Daroszewski aufgeführt, der 1816 in Zgłowiączka zur Welt kommt und dort 1817 stirbt. In der Genealogie gilt: Was nicht belegt ist, ist nicht bewiesen und somit nur eine Annahme!
Was mache ich, wenn ich keine Standesamtunterlagen habe? Ich brauche auf jeden Fall einen Ort, in dem das Lebensereignis (Geburt, Hochzeit, Tod) stattgefunden hat und suche dann nach Kirchenbüchern. Diese sind in den Zeiten vor Einführung der Standesämter sowieso die Hauptdatenquelle.
Es gibt digitalisierte Kirchenbücher der evangelischen Kirche in Deutschland bei Archion, das kostenpflichtig ist. Die katholische Kirche veröffentlicht im Portal Matricula.
So, das ist der erste Teil der Einführung in die Ahnenforschung. Schreibt Fragen und Anmerkungen gerne in die Kommentare. Der nächste Teil wird sich mit Vereinen, Archiven und öffentlichen Datenbanken befassen.